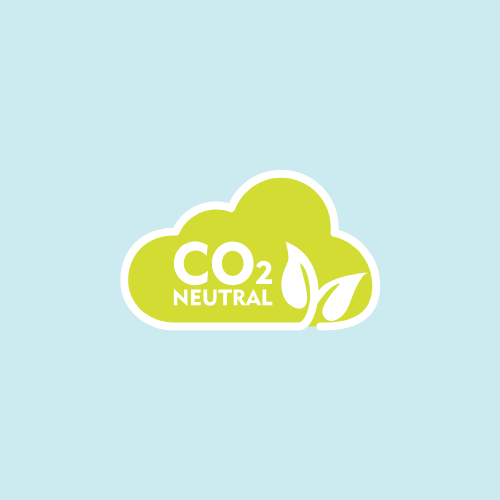Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, das ist im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegt. Ende 2023 wurde die Volksinitiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ angemeldet, die seither um Unterstützung für ihr Vorhaben wirbt. Nach einem erfolgreichen Volksbegehren folgt nun der nächste Schritt: der Volksentscheid. Am 12. Oktober 2025 stimmen alle wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger über den Volksentscheid ab. Der genaue Gesetzestext, über den entschieden wird, findet sich hier. Stimmt die Mehrheit für den Gesetzestext, tritt er innerhalb eines Monats in Kraft.
Im Folgenden beantworten wir dazu die wichtigsten Fragen.
Was will der Zukunftsentscheid?
Die Bürgerinitiative will ein strengeres Klimaschutzgesetz für Hamburg. Ziel ist es, statt bis 2045 Hamburg schon bis 2040 klimaneutral zu machen, also fünf Jahre früher als geplant. Dafür soll es u.a. verbindliche CO2-Minderungsziele für alle Sektoren (zum Beispiel Bau, Verkehr, Industrie, Haushalte) geben.
Warum sollte ich mit NEIN abstimmen?
Wer mit NEIN abstimmt, stimmt für einen sozial verantwortungsbewussten Klimaschutz. Denn schon jetzt wird viel Geld investiert, um die notwendige Wärmewende zu schaffen. Zuletzt investierten die Hamburger VNW-Mitgliedsunternehmen rund anderthalb Milliarden Euro pro Jahr – davon ein Drittel in die Modernisierung von Bestandsgebäuden. Je kürzer der Zeitraum ist, in dem energetisch durchsaniert werden muss, desto teurer wird es nicht nur für die Unternehmen, sondern für uns alle. Ein Vorziehen des Klimaneutralitäts-Ziels um fünf Jahre würde die VNW-Mitgliedsunternehmen jedes Jahr 800 Millionen Euro kosten. In der Folge bedeutet das höhere Mieten, denn Kosten müssen refinanziert werden. Eine große Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft hat ausgerechnet, dass sie bis 2040 die Mieten bei den rund 2300 Wohnungen, die noch klimaneutral ertüchtigt werden müssen, um 3,37 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche erhöhen muss. Wenn wir das gleiche Ziel in 25 Prozent weniger Zeit schaffen sollen, brauchen wir ab sofort 25 Prozent mehr Eigenkapital. Wer die Mehrbelastungen für Mieterinnen und Mieter verschweigt, handelt unredlich. Ein Gutachten im Auftrag der Hamburger Umweltbehörde zu den Möglichkeiten einer vorzeitigen Klimaneutralität gibt uns Recht. Die Ergebnisse der Studie des Ökoinstituts lassen erhebliche negative Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt in Hamburg befürchten.
Die Initiative, die für den Volksentscheid am 12. Oktober verantwortlich zeichnet, verrät nicht, woher die Mehrkosten für den kürzeren Zeitraum kommen soll. Sie hat keine Berechnungen über die finanziellen Auswirkungen des Vorziehens von Klimaneutralität vorgelegt. Stattdessen erweckt sie Eindruck, es werde die Menschen kaum etwas kosten. In ihrer Argumentation bleibt sie dabei aber schwammig.
Die Initiative behauptet, dass die Mieten bei Klimaneutralität laut Hamburger Stadtentwicklungsbehörde im Durchschnitt lediglich um 30 Cent pro Quadratmeter Wohnflächen steigen würden. Richtig hingegen ist: Wissenschaftler haben mit Blick auf Klimaneutralität 2045 drei Szenarien erarbeitet. Die getroffene Aussage der Behörde bezieht sich auf das Szenario zwei und auf das Erreichen von Klimaneutralität im Jahr 2045. Wenn der Hamburger Wohnungsbestand aber bereits 2040 klimaneutral sein soll, gilt das Szenario drei mit einer deutlich höheren Sanierungsrate und Sanierungstiefe. Das Szenario drei geht von Investitionskosten in Höhe von 55,4 Milliarden Euro aus. Das sind 16 Milliarden Euro mehr als beim Szenario zwei. Klimaneutralität fünf Jahre früher bedeutet den Wissenschaftlern zufolge also 41 Prozent Mehrkosten. Diese Zahlen verschweigen die Vertreter der Klimainitiative, genauso wie die Tatsache, dass die Mehrkosten die Mieter zu tragen haben. Unsere Sorge vor massiv steigenden Mieten ist also wissenschaftlich begründet. Das trifft im Übrigen auch auf die konkreten Wohnfolgekosten zu: Im Szenario zwei ist von durchschnittlich 1,57 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche die Rede. Im Szenario drei wurde die Berechnung nicht angestellt. Es ist aber davon auszugehen, dass diese auch hier deutlich höher liegen werden als bei Szenario zwei.
Eine staatliche Förderung aus Steuergeldern, die die Mehrkosten übernimmt, ist unrealistisch. Es ist zwar richtig, dass Kosten einer Modernisierung nur anteilig in Höhe von acht Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten und auch nur bis zu einer bestimmten Höhe auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden dürften. Allerdings ist es bei den VNW-Mitgliedsunternehmen so, dass die Mieten aktuell in der Regel deutlich unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen (Monatliche Durchschnittsmiete der Hamburger VNW-Mitgliedsunternehmen: 7,61 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Durchschnittswert des vom Hamburger Senat veröffentlichten Hamburger Mietenspiegels: 9,81 Euro pro Quadratmeter) und die gesetzlich zulässigen Mieterhöhungsmöglichkeiten bislang nicht ausgeschöpft wurden. Klimazielbedingte bauliche Mehrkosten werden also in vielen Fällen als Modernisierungsmaßnahme auf den Mieter umlegbar sein.
Ein vorgezogener Termin bedeutet auch: Steht weniger Zeit zum Erreichen von Klimaneutralität zur Verfügung, steigt die Zahl der vorfälligen Sanierungen. Dann würden Dächer erneuert, Heizungen und Fenster ausgetauscht, obwohl sie das Ende ihrer technischen Lebensdauer noch gar nicht erreicht haben. Das ist weder nachhaltig noch wirtschaftlich.
Wenn durch das Vorziehen auf das Jahr 2040 alles in die energetische Sanierung fließen müsste, gäbe es viel weniger finanziellen Spielraum für Neubau und Instandhaltung – bei dem angespannten Hamburger Wohnungsmarkt wäre das fatal.
Der eklatante Fachkräftemangel in der Branche macht ein Vorziehen des Klimaneutralität-Ziels der Erfahrung unserer Mitgliedsunternehmen nach ohnehin vollkommen unrealistisch. Sollte das Ziel jedoch gesetzlich feststehen, drohen Klagen.
Kann ich auch per Briefwahl abstimmen?
Ja, das geht. Weitere Infos dazu gibt es hier.
Warum ist Klimaneutralität 2040 für die VNW-Mitgliedsunternehmen nicht zu schaffen?
Die VNW-Mitgliedsunternehmen sind die sozialen Vermieter mit Werten. Es sind Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften, bei denen nicht die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt steht, sondern die in ihre Bestände und den Neubau investieren und ihre Angestellten bezahlen. Das heißt, es gibt keine riesigen Rücklagen, die einfach angezapft werden können. Vier von fünf VNW-Unternehmen lehnen ein Vorziehen des Klimaneutralität-Ziels auf 2040 ab, weil die Investitionen sonst nicht mehr aus bezahlbaren Mieten zu finanzieren sind. Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Bauprojekte sind langfristige Projekte. Unsere Mitgliedsunternehmen planen mit 2045. Diese Pläne plötzlich umzuwerfen würde enorme Kosten verursachen.
Was will der VNW stattdessen?
Wir erwarten von allen Beteiligten in der Diskussion um Klimaneutralität Ehrlichkeit und Transparenz. Nur auf die Vorteile zu verweisen, die zusätzlichen Kosten jedoch zu verschweigen oder sie ‚dem Staat‘, also allen Steuerzahlenden, aufzudrücken, das geht nicht. Unsere Mitgliedsunternehmen möchten die Klimawende sozialverträglich organisieren. Dafür sollten Klimaschutzmaßnahmen und Gesetzesvorhaben pragmatisch und realistisch angegangen werden. 2045 als Zieljahr für die Klimaneutralität der Stadt ist schon ambitioniert genug. Das stellt alle Sektoren vor große Herausforderungen.
Wer trägt die Kosten für die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen?
Laut Expertenstudie des Hamburger Senat kostet es mindestens 40 Milliarden Euro, alle Wohngebäude Hamburgs bis 2045 klimaneutral zu machen - bei rund einer Million Wohnungen, die es in der ganzen Stadt gibt, sind das fast 40.000 Euro pro Wohnung. Das Pestel Institut spricht sogar von insgesamt rund 54 Milliarden Euro. Sollte das Ziel der Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2040 vorgezogen werden, müsste dieses Geld schon innerhalb von 15 Jahren aufgebracht werden. Das wären dann allein bei dem niedrigeren Zahlenbeispiel des Hamburger Senats mindestens 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. Unterdessen steigen Baupreise und Zinskosten stetig weiter an. Wie diese Summen aufgebracht werden sollen und wer sie bezahlen soll, ist unklar. Die Initiative, die den Volksentscheid organisiert hat, hat darauf keine Antwort geliefert. Durch Steuergelder ist das sicher nicht “wegzufördern”.
Hinzu kommt, dass das Versprechen niedrigerer Heizkosten wohlfeil ist: Nach einer energetischen Sanierung sinken sie erfahrungsgemäß weniger stark als vorher versprochen und wiegen die Mehrkosten, die durch eine Sanierung entstanden sind, bei Weitem nicht auf. Am Ende werden Mieterinnen und Mieter also draufzahlen. Wir gehen aufgrund der Studien und eigener Berechnungen unserer Mitgliedsunternehmen von einer zusätzlichen monatlichen Mietsteigerung von bis zu 1,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche aus, die auf rund 3 Euro Mehrkosten in dem Zeitraum on top gerechnet werden muss. Ebenfalls die Warmmiete erhöhen werden die steigenden Energiekosten: Die Hamburger Energiewerke haben erst kürzlich ihre Preise deutlich angehoben , um die Investitionen in die Wärmewende stemmen zu können. Neukunden müssen seit dem 1. Mai fast ein Drittel mehr für Fernwärme und Heißwasser bezahlen. Die Erhöhungen für Bestandskunden folgen schrittweise ab dem 1. Juli 2026. Eine erhebliche finanzielle Belastung für viele Haushalte.
Wie geht es weiter, falls der “Zukunftsentscheid” erfolgreich ist?
Laut Hamburger Wahlrecht ist es so, dass der Volksentscheid als angenommen gilt, wenn die Mehrheit der Abstimmenden und mindestens ein Fünftel der Wahlberechtigten (263.338 Personen) zustimmen. Dies gilt, wenn ein Volksentscheid nicht am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag stattfindet - also auch für den “Hamburger Zukunftsentscheid”. Sollte der Volksentscheid zugunsten der Bürgerinitiative ausgehen, drohen Klagen gegen alle, die die geforderten Maßnahmen nicht erfüllen, sowie gegen die Freie und Hansestadt Hamburg, sollte die per Gesetz verordnete Klimaneutralität 2040 nicht erreicht werden.